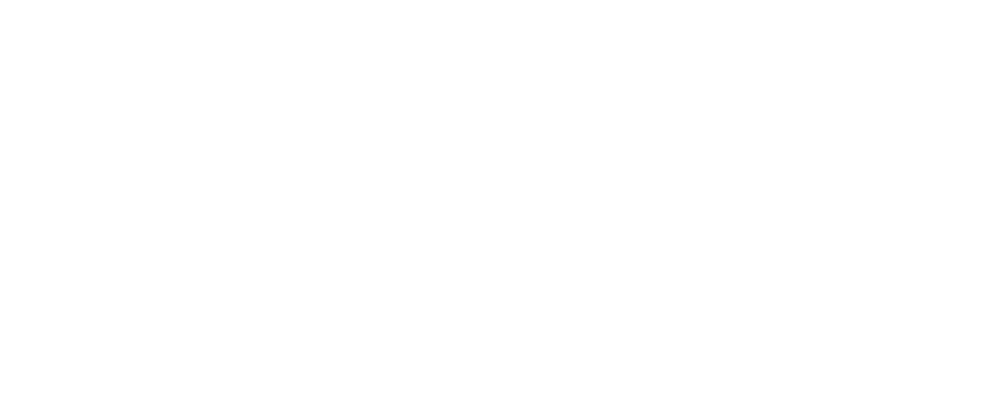Wir haben uns schon mehrfach und kräftig zugunsten aller jungen Geister ausgesprochen, die im Dienste des Jahrhunderts handeln und die Interessen und Fragen der Gegenwart mit Kopf und Herzen ergreifen, und, wenn nicht lösen, doch nach Kräften neues Licht über dieselben zu verbreiten sich bestreben.
Der marmorne Ruhm unserer deutschen Klassiker ist gesichert für lange, vielleicht für ewige Zeiten; mögen einige Stubengelehrte sie beharrlich bald vom Standpunkte des Christentums, bald von dem des Heidentums aus betrachten und ihnen danach ihre Stelle anweisen – sie werden ihrer Unsterblichkeit dadurch weder Vorschub leisten noch Abbruch tun.
Ein Journal, glaubten wir und glauben dies bis heute, habe es vorzüglich mit dem lebenden Geschlechte zu tun; wie eine Pflanze der Wärme des Sonnenlichts, so bedürfe der werdende Dichter der Liebe seines Volkes, um heranzugedeihen zu dessen Freude und Trost.
Und doch will ich heute einen Schatten, einen edlen Schatten heraufbeschwören, den wir unverantwortlicherweise beinahe ganz vergessen haben. So nachdrücklich ich stets die Teilnahme der Nation für ihre lebenden Genien verlangt habe, so weit war ich immerdar von der irrigen Meinung entfernt, als ob ein echter Dichter je aufhören könnte, der Dichter der Zeit zu sein. Das Göttliche ist immer an der Zeit…
Hölderlin! von ihm wollte ich schreiben, und das Herz pocht mir schon, wenn ich an ihn denke! – – –
Hölderlin, der eigentlichste Dichter der Jugend, dem Deutschland eine große Schuld abzutragen hat, weil er an Deutschland zugrunde gegangen ist. Aus unsern jämmerlichen Zuständen, ehe noch unsere Schmach voll wurde, hat er sich in die heilige Nacht des Wahnsinns gerettet, er, der berufen war, uns voranzuschreiten, und uns ein Schlachtlied zu singen.
Ach! er hat sich umsonst gewünscht zu fallen am Opferhügel, zu bluten des Herzens Blut fürs Vaterland! Tatlos schmachtet er hin an den Ufern des heimatlichen Stromes, den er so oft verherrlicht; während ich mich berausche in seinen Liedern, hat er vielleicht vergessen, daß er jemals eines gedichtet.
Es ist rührend mit anzusehen, welche Anhänglichkeit die akademische Jugend dem wahnsinnigen Dichter in Tübingen bewahrt hat; mehr als Neugierde mag es sein, wenn sie zu dem 70jährigen Greise wallfahrt, der ihr nichts mehr bieten kann, als einige übelgegriffene Akkorde auf einem elenden Klaviere.
„Was die Jugend glaubt, ist ewig“, sagt einmal Börne, und dieser Ausspruch findet seine Wahrheit an Hölderlin. Obgleich bald vier Dezennien vorübergerauscht sind, seit der Verfasser des Hyperion sein letztes Lied gedichtet, zünden die großen Worte desselben noch so mächtig in den jugendlichen Gemütern, als ob sie erst gestern gesprochen worden wären. Wenig dichterische Köpfe sind in Schwaben, die Hölderlin nicht ein paar Strophen geweiht, oder in seiner Nähe ein paar Stunden verlebt hätten.
Er hat auch wohl für die mit dem Altertum sich beschäftigende Jugend mehr Wert, als der größte Philolog. Er wollte uns das Schönste aus jenen klassischen Zeiten erobern, den freien, großen Sinn.
Mit solchen unbequemen Anforderungen fand er natürlich im Anfange dieses Jahrhunderts keinen großen Anklang. Was Wunder, wenn er dann zürnend ausruft:
„Es ist herzzerreißend, wenn man Euere Künstler, Euere Dichter sieht, und Alle, die den Genius noch achten, die das Schöne lieben und pflegen! Die Guten! Sie leben in der Welt, wie Fremdlinge im eigenen Hause; sie sind so recht wie der Dulder Ulyß, da er in Bettlersgestalt an seiner Türe saß, indeß die unverschämten Freier im Saale lärmten und fragten, wer hat uns den Landstreicher gebracht?“
Oder an einer anderen Stelle:
„Voll Lieb und Geist wachsen seine Musenjünglinge dem deutschen Volke heran; du siehst sie sieben Jahre später, und sie wandeln wie die Schatten, still und kalt, sind wie ein Boden, den der Feind mit Salz besäet, daß er nimmer einen Grashalm treibt, und wenn sie sprechen, wehe dem! der sie versteht, der in der stürmenden Titanenkraft, wie in ihren Proteuskünsten den Verzweiflungskampf nur sieht, den ihr zerstörter schöner Geist mit den Barbaren kämpft, mit denen er es zu tun hat.“
Hölderlin wußte, wie groß die Welt einst war, und konnte es nicht verschmerzen, daß sie so klein geworden sei. Es war ihm ringsum zu wild, zu bange, es trümmerte und wankte, wohin er blickte… Er mußte wandern von Fremden zu Fremden und die freie Erde mußte ihm leider statt des Vaterlands dienen… Aber
nimmer vergaß er dich,
So fern er wandert‘, schöner Main –
und nicht des Neckars Gestade.
Er ist mit Leib und Seele ein Deutscher geblieben und hat trotz allem unserem Elend die Hoffnung nie aufgegeben. Er begriff, daß
Mit ihrem heil’gen Wetterschlage,
Mit Unerbittlichkeit vollbringt
Die Not an Einem großen Tage,
Was kaum Jahrhunderten gelingt;
Und wenn in ihren Ungewittern
Selbst ein Elysium vergeht,
Und Welten ihrem Donner zittern,
Was groß und göttlich ist, besteht.
… – Träume dich hin zu deinem Plato, „Echo des Himmels, heiliges Herz“, träume dich hin in den Schatten der Platanen, zu den Blumen des Ilissus, – aber eine glückliche Hand möge unserer Jugend die Zeugnisse deines Geistes sammeln, daß sie sich von neuem daran erbaue, wenn die dunkle Wolke der Gegenwart drückend über ihrem Haupte lastet! Wir haben soviel Zeit für das Unzeitgemäßeste, und bedenken uns wegen der Minute, die wir einem so himmlischen Genius weihen wollen?
Georg Herwegh, zuerst in: Deutsche Volkshalle, 1839